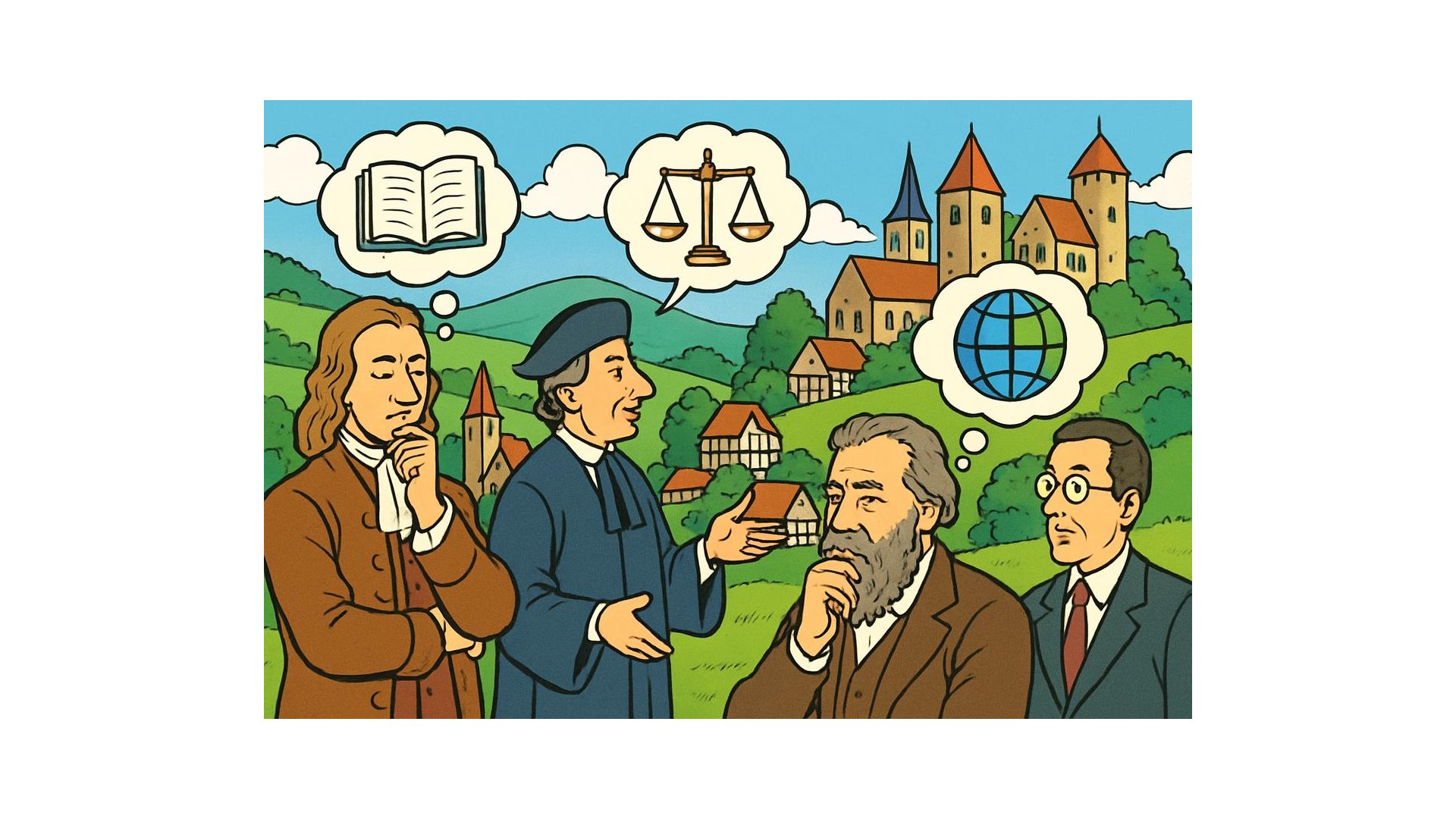Obwohl Westfalen nie ein eigener Staat war, brachte die Region einige der einflussreichsten Staats- und Gesellschaftstheoretiker hervor – von Johannes Althusius bis Niklas Luhmann. Zwischen brillanten Denkern und belasteten Geistern entfaltete sich hier über Jahrhunderte eine bemerkenswerte intellektuelle Tradition, die bis heute nachwirkt.
Es ist eine der Paradoxien der deutschen Geistesgeschichte: Ausgerechnet eine Region, die nie als eigenständiger Staat existierte, entwickelte über die Jahrhunderte eine außergewöhnliche Dichte an Denkern, die sich mit den Grundfragen des Staatswesens beschäftigten. Westfalen brachte Juristen, Philosophen und Soziologen hervor, deren Theorien weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus wirkten – im Guten wie im Problematischen.
Die frühen Wegbereiter
Am Anfang dieser Tradition steht Johannes Althusius aus Bad Berleburg, einer der frühesten und bis heute wirkungsmächtigsten westfälischen Staatstheoretiker. Seine Konzeption der Politik als Kunst, Menschen zu vergemeinschaften, prägte nachfolgende Generationen und gilt als wichtiger Beitrag zur Entwicklung föderalistischen Denkens.
Aus Iserlohn stammte Johann Stephan Pütter, über den es in zeitgenössischen Quellen heißt, er sei seinerzeit wohl der bedeutendste und erfolgreichste Staatsrechtslehrer, wenn nicht Rechtslehrer überhaupt gewesen. Sein Einfluss auf die Rechtswissenschaft seiner Zeit kann kaum überschätzt werden.
Justus Möser, vom Schriftsteller Martin Mosebach als „erster und wichtigster Kritiker des absolutistischen Staates“ beschrieben, setzte sich in seinen „Patriotischen Phantasien“ intensiv mit Fragen des Staatswesens und des Rechts auseinander. Seine Kritik am zentralistischen Staatsdenken und sein Eintreten für gewachsene lokale Strukturen machten ihn zu einem Vordenker konservativen politischen Denkens.
Umstrittene Geister
Die westfälische Denktradition kennt allerdings auch ihre dunklen Kapitel. Carl Schmitt aus Plettenberg, bis heute einer der umstrittensten Juristen des 20. Jahrhunderts, wurde zum „Kronjuristen“ der Nationalsozialisten. Sein scharfsinniger Geist und seine analytische Brillanz stehen in einem kaum auflösbaren Spannungsverhältnis zu seiner politischen Verstrickung. Ähnlich belastet ist Helmut Schelsky, der trotz seiner Nähe zum Nationalsozialismus als Gründungsprofessor der Universität Bielefeld die erste Soziologie-Fakultät Deutschlands ins Leben rief.
Auch Johann Plenge, auf den der zweifelhafte Begriff der „Volksgemeinschaft“ zurückgeht, gehört zu jenen Figuren, deren intellektueller Einfluss historisch nicht folgenlos blieb. Diese Namen mahnen zur kritischen Reflexion: Intellektuelle Brillanz schützt nicht vor moralischem Versagen.
Die Systemtheoretiker und Gesellschaftsdenker
Zu den bedeutendsten und produktivsten Gesellschaftstheoretikern des 20. Jahrhunderts zählt unzweifelhaft Niklas Luhmann aus Bielefeld. Selbst sein langjähriger intellektueller Widersacher Jürgen Habermas bescheinigte ihm, ein großer Geist zu sein, von dem man viel lernen könne. Luhmanns systemtheoretischer Ansatz revolutionierte die Soziologie und beeinflusst bis heute Denken und Forschung weit über die Grenzen des Fachs hinaus. Bis zu seinem Tod wohnte er in Oerlinghausen – jenem Ort, aus dem auch Marianne Weber stammte, die Ehefrau Max Webers.
Diese Verbindung ist mehr als biografische Fußnote: Max Webers Vater entstammte einer Bielefelder Unternehmerfamilie, und seine wohl einflussreichste sozialwissenschaftliche Theorie, die „Protestantische Ethik“, fand ihre empirische Vorlage in den ostwestfälischen Verhältnissen. Kaum bekannt ist diese ostwestfälische Wurzel einer der wirkmächtigsten Theorien der Sozialwissenschaften.
Ein weiterer Soziologe, der eine eigene Gesellschaftstheorie entworfen hat, ist Günter Dux, der an der Universität Freiburg lehrte. Seine Arbeiten zur historisch-genetischen Theorie erweiterten das Spektrum soziologischen Denkens um wichtige Perspektiven.
Völkerrecht und Anthropologie
Auch im Völkerrecht hinterließ Westfalen bedeutende Spuren. Walther Adrian Schücking war als erster Deutscher ständiger Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Ihm zu Ehren wurde das 1914 gegründete Kieler Institut für Internationales Recht 1995 in Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht umbenannt. Gustav von Ewers begründete die Russische Rechtsgeschichte als eigenständiges Lehrfach und schuf damit eine neue wissenschaftliche Disziplin.
Einen besonderen Platz in dieser Reihe nimmt Franz Boas aus Minden ein. Als Begründer der modernen Anthropologie fällt er im positiven Sinne aus der Reihe der Staatsdenker heraus. Der legendäre Claude Lévi-Strauss bezeichnete ihn als „einen der letzten Titanen des 19. Jahrhunderts“. Boas‘ Kampf gegen den Rassismus und seine Betonung des kulturellen Relativismus machten ihn zu einer der wichtigsten Figuren der Humanwissenschaften.
Das juristische Erbe
Es verwundert vor diesem Hintergrund nicht, dass sowohl der erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hermann Höpker-Aschoff, als auch der ehemalige Präsident Andreas Voßkuhle aus Westfalen stammen. Im münsterländischen Hopsten wuchs Alexander von Stahl auf, der von 1990 bis 1993 Generalbundesanwalt war. Die westfälische Tradition des juristischen und staatstheoretischen Denkens setzt sich bis in die Gegenwart fort.
Fazit
Die westfälische Denktradition ist reich und widersprüchlich zugleich. Sie reicht von wegweisenden Theoretikern des föderalen Staatsdenkens über brillante Systemtheoretiker bis zu intellektuell herausragenden, aber moralisch kompromittierten Figuren. Vielleicht war es gerade das Fehlen eines eigenen westfälischen Staates, das den Blick seiner Gelehrten für die grundsätzlichen Fragen der politischen Ordnung schärfte. Diese Denker mussten sich nicht mit der Verwaltung bestehender Verhältnisse begnügen, sondern konnten sich den fundamentalen Fragen nach der richtigen Ordnung des Gemeinwesens widmen. So wurde aus der staatenlosen Region ein Zentrum des Staatsdenkens – eine Ironie der Geschichte, die bis heute nachwirkt.