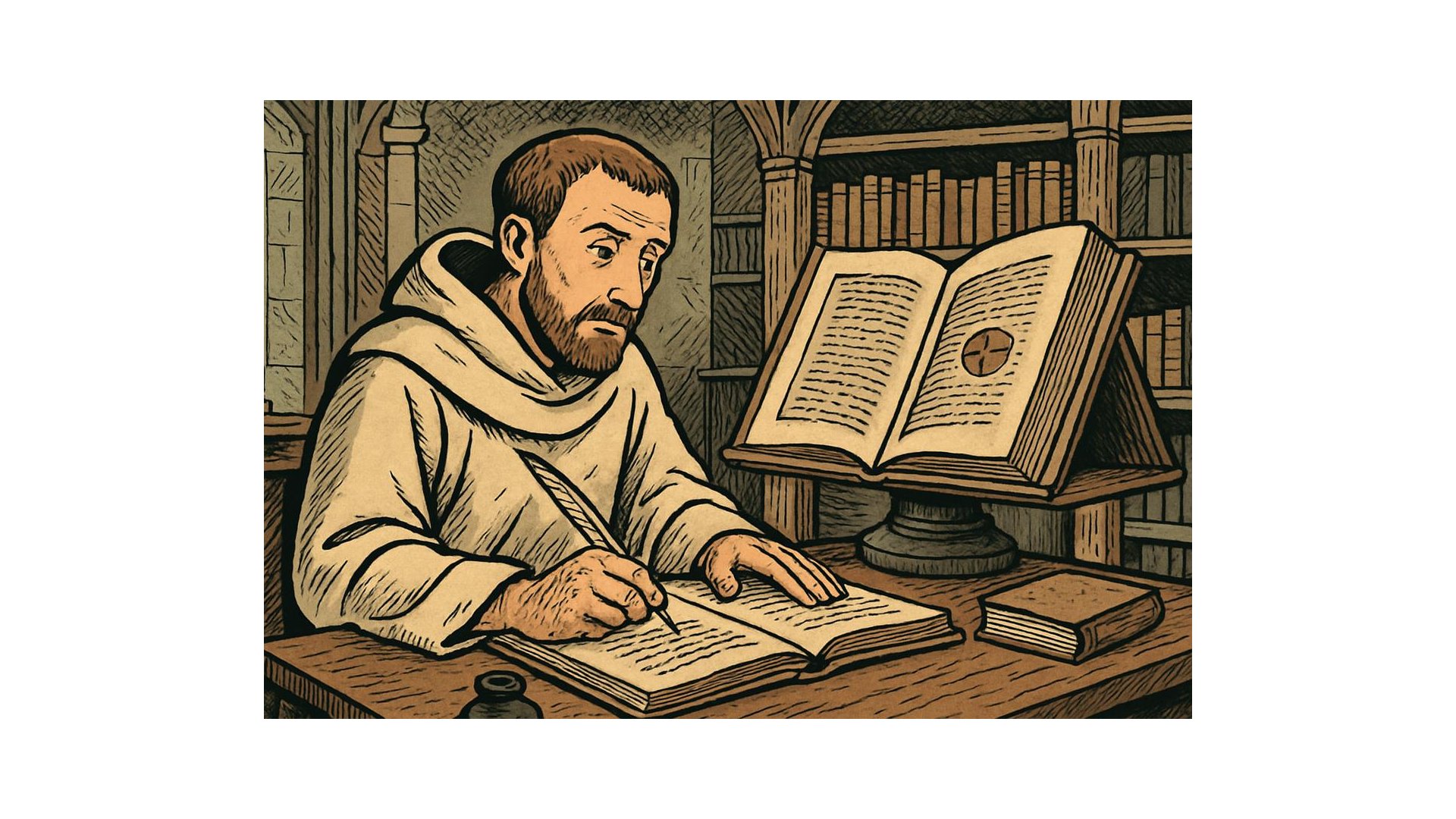Ein Kartäuser aus Köln kämpft gegen Vorurteile – und schafft dabei neue Mythen. Werner Rolevincks „Westfalenlob“ von 1474 ist weit mehr als eine Lobschrift: Es ist der erste Versuch, die Identität einer deutschen Landschaft kulturgeschichtlich zu fassen.
Im 15. Jahrhundert hatte Westfalen ein Problem. Nicht mit sich selbst, sondern mit seinem Ruf. Wer damals von Westfalen sprach, verband damit offenbar wenig Schmeichelhaftes – genug jedenfalls, um Werner Rolevinck, einen gebürtigen Westfalen aus Laer im Münsterland, der sein Leben als Kartäusermönch in Köln verbrachte, zum Schreiben zu bewegen. Was er 1474 vorlegte, war bemerkenswert: das erste Buch, das einer deutschen Landschaft eine eigene Kulturgeschichte zuschrieb. Das Buch zum Lobe Westfalens, kurz Westfalenlob, war Imagekorrektur und Identitätsstiftung zugleich – ein Text, der bis heute nachwirkt.
Rolevinck war kein weltfremder Schwärmer. Als produktiver Autor überwiegend theologischer Schriften verfügte er über einen scharfen Blick auf die Verhältnisse seiner Zeit. Er wusste, dass Westfalen im 15. Jahrhundert unter einem existenziellen Druck stand: Viele Bewohner mussten ihre Heimat verlassen, um anderswo ihr Auskommen zu finden. Von Gotland bis Italien traf man auf Westfalen, die sich in der Fremde durchschlugen – und oft zu geachteten Bürgern aufstiegen. Diese erzwungene Diaspora war keine Randerscheinung, sondern prägte das Selbstverständnis der Region.
Aus dieser Not machte Rolevinck eine Tugend. Was andere als Schwäche hätten deuten können – die Unfähigkeit, die eigenen Leute zu ernähren – deutete er zur „hohen Sendung der Westfalen in der Welt“ um. Die Westfalen, so sein Argument, seien überall dort tätig, wo sie gebraucht würden, und erfüllten ihre Pflicht zum Wohle des Gemeinwesens. Ein Narrativ, das sich hartnäckig hielt und in abgewandelter Form bis in die Gegenwart fortlebt.
„Wenn ich von der großen Rechtschaffenheit der Westfalen und ihrer in aller Welt bewährten Tüchtigkeit schreiben soll, weiß ich kaum, was ich zuerst erzählen soll“, beginnt Rolevinck sein Kapitel über die westfälische Sendung. Was folgt, ist eine Aufzählung von Charaktereigenschaften, die man heute als Markenkern bezeichnen würde: Treue vor allem. „Oh du treuer Westfale!“ – diesen Ausspruch habe er seit Kindertagen von anderen Völkern gehört, schreibt Rolevinck. Bis heute hält sich die Formel: „Westfalen halten, was andere versprechen.“
Doch das Westfalenlob ist mehr als bloße Lobhudelei. Rolevinck benennt auch Probleme und Defizite. Westfalen besaß damals keine eigene Universität – ein gravierender Nachteil in einer Zeit, in der Bildung zunehmend an institutionelle Zentren gebunden war. Doch auch hier dreht Rolevinck die Perspektive: Der „Bildungshunger der Westfalen“ kenne keine geografischen oder fachlichen Grenzen. Und tatsächlich stammten bedeutende Gelehrte des Mittelalters aus der Region: Hermann von Höxter, der erste regens doctor der medizinischen Fakultät in Heidelberg, Otto Tachenius, Johannes Wesling, David Gans, Johannes Althusius und andere. Auch in Westfalen selbst wirkten herausragende Köpfe wie Reinher von Paderborn an der Domschule.
Die Liste der westfälischen Erfolgsgeschichten ist lang: Kaufleute der Hanse, Ordensritter und Landmeister, später Auswanderer in die Neue Welt. Rolevinck zeichnet das Bild einer Region, die ihre Stärke aus der Mobilität und Anpassungsfähigkeit ihrer Menschen zieht – ein Muster, das sich über Jahrhunderte fortsetzt.
Natürlich ist das Buch nicht frei von Verzerrungen. Die Rolle der Kirche wird glorifiziert, manches wird überhöht. Doch gemessen an seiner Zeit ist Rolevincks Werk erstaunlich differenziert. Er liefert nicht nur Propaganda, sondern auch Lebensweisheiten und philosophische Reflexionen, die über den unmittelbaren Anlass hinausweisen. Was das Westfalenlob so bemerkenswert macht, ist sein Versuch, das „Wesen“ einer Landschaft zu fassen – ihre Eigenart, ihre Mentalität, ihre Rolle in einem größeren Zusammenhang.
Werner Rolevinck kämpfte gegen Stereotype – und schuf dabei neue. Doch er tat mehr: Er gab einer Region eine Erzählung, die ihr half, sich selbst zu verstehen. Das Westfalenlob ist deshalb nicht nur ein historisches Dokument, sondern ein frühes Beispiel für regionale Identitätspolitik. Die Lektüre lohnt sich noch immer – nicht nur für Westfalen, sondern für jeden, der verstehen will, wie Identität entsteht: durch Geschichten, die wir über uns erzählen.