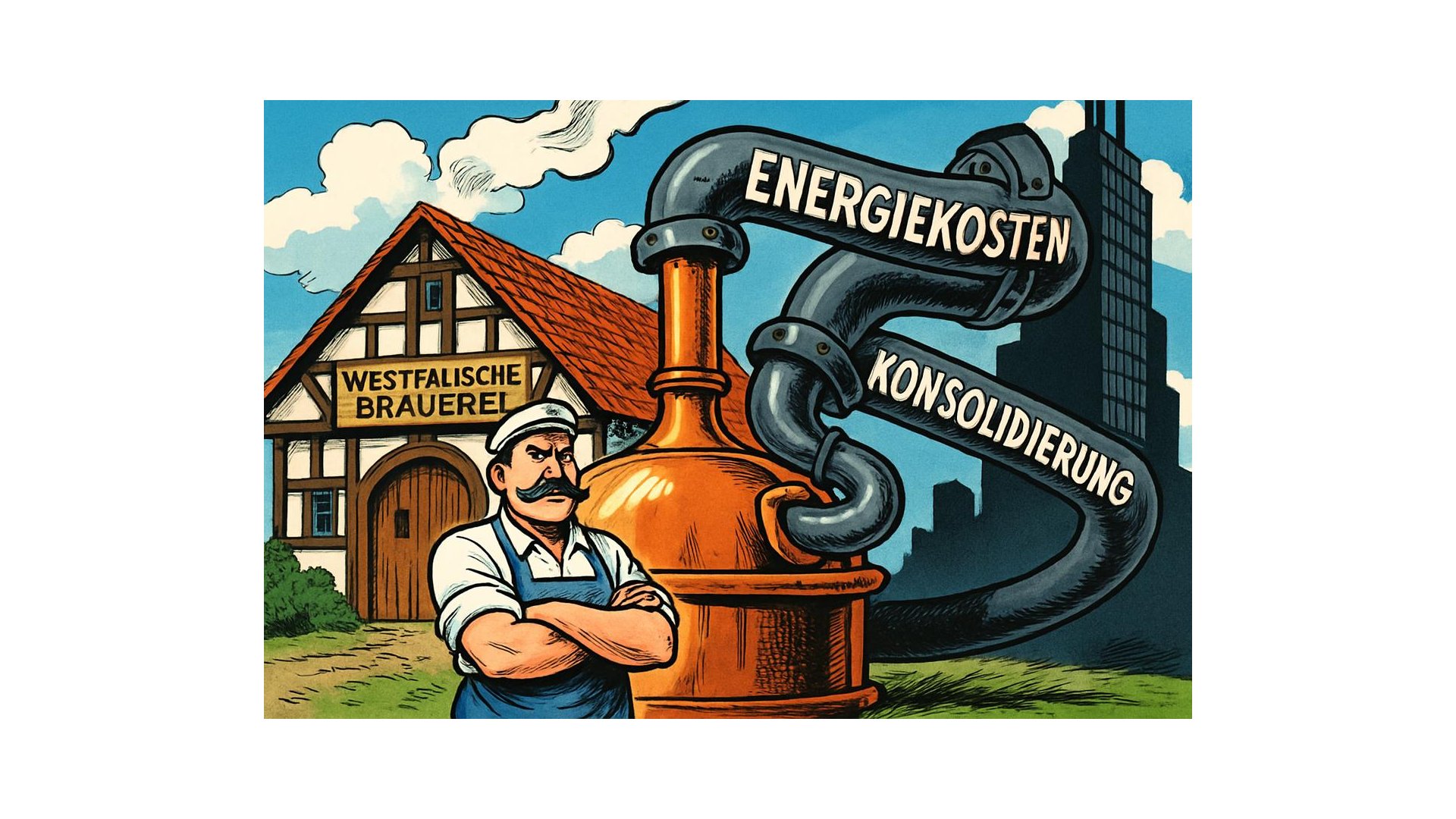Die Namen Krombacher, Veltins, Warsteiner stehen nicht nur für Bier, sondern für ein spezifisch westfälisches Wirtschaftsmodell: mittelständisch geprägt, familiengeführt, regional verwurzelt – und doch global erfolgreich. Die Geschichte des westfälischen Brauwesens erzählt von den Stärken einer Industriekultur, die heute vielerorts unter Druck gerät.
Wer die großen Privatbrauereien Deutschlands aufzählt, führt eine Liste westfälischer Unternehmen an. Krombacher, Veltins und Warsteiner – drei Namen, die für mehr stehen als für gelungene Marketingkampagnen und Perlenglanz im Glas. Sie markieren ein wirtschaftshistorisches Phänomen, das in seiner Konzentration bemerkenswert ist: die Herausbildung einer regionalen Brauwirtschaft, die nationale Bedeutung erlangte, ohne ihre lokale Verankerung preiszugeben.
Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die deutsche Brauwirtschaft durchlief im 20. Jahrhundert mehrere Konsolidierungswellen, die andernorts zu Konzernstrukturen und dem Verschwinden regionaler Marken führten. Die Radeberger-Gruppe, heute Teil des Oetker-Konzerns und größter Bierproduzent des Landes, steht exemplarisch für diese Entwicklung: ein Konglomerat aus zugekauften Traditionsmarken unter einer zentralen Holding. Westfalen jedoch brachte daneben noch ein anderes Modell hervor – eines, das auf Familienunternehmen, langfristigem Denken und einer spezifischen Form regionaler Identität basierte.
Die Biografien der westfälischen Brauereibesitzer und Braumeister lesen sich wie ein Who’s Who der deutschen Biergeschichte: Theodor König aus Lünen, der die König-Brauerei in Duisburg begründete. Albert Cramer, unter dessen Führung Warsteiner zum nationalen Player aufstieg. Fritz Brinkhoff, Gründungsbraumeister der Dortmunder Union und Namensgeber einer Marke, die bis heute im kollektiven Gedächtnis des Ruhrgebiets verankert ist. Friedrich Schadeberg, der als Pionier der Brauwirtschaft Krombacher zu dem machte, was es heute ist. Rosemarie Veltins, die das regionale Familienunternehmen C. & A. Veltins zu einer der größten Brauereien des Landes führte.
Doch die westfälische Brautradition beschränkt sich nicht auf die großen Namen. Betriebe wie die Potts Brauerei in Oelde, Strate Bier, Barre Bräu, Hohenfelder, Moritz Fiege oder Warburger Bier stehen für eine Vielfalt regionaler Brauwirtschaft, die das industrielle Gesicht Westfalens ebenso prägte wie die großen Marken. Sie repräsentieren jene mittlere Ebene zwischen Lokalbrauerei und nationalem Konzern, die für die Struktur der deutschen Brauwirtschaft lange Zeit charakteristisch war – und die heute besonders unter Druck steht. Diese Brauereien waren und sind mehr als bloße Produzenten: Sie sind Arbeitgeber, Identitätsstifter, Teil des lokalen Selbstverständnisses ihrer Regionen.
Was diese Unternehmerbiografien verbindet, ist mehr als der geografische Zufall. Sie verweisen auf eine spezifisch westfälische Wirtschaftskultur, die auf Beständigkeit, technischer Exzellenz und einer eigentümlichen Mischung aus Lokalpatriotismus und Expansionswillen beruht. Die westfälischen Brauer verstanden es, ihre Produkte als Träger regionaler Identität zu positionieren – und gleichzeitig bundesweit zu vermarkten. Ihre Marketingstrategien von „Westfälische Tradition“ bis „Perle der Natur“ funktionieren gerade deshalb, weil sie auf realer regionaler Verwurzelung basieren, nicht auf nachträglich konstruiertem Storytelling.
Dass diese Tradition auch für den Export taugte, zeigen die Karrieren westfälischer Brauer im Ausland – und zwar in bemerkenswerter Bandbreite. Karl Adolf Bachofen von Echt wurde k.u.k.-Hoflieferant und Inhaber der Nußdorfer Bierbrauerei in Wien. Joseph Griesedieck (1863-1938) machte mit seiner Familie das Falstaff-Bier in den Vereinigten Staaten zu einer Erfolgsmarke. Johann Peter von Reininghaus etablierte sich in der österreichischen Brauwirtschaft. Der Brauingenieur Karl Strauss schließlich wurde für seine technischen Innovationen international ausgezeichnet. Sie exportierten nicht nur Bier, sondern westfälisches Know-how und eine Geschäftsphilosophie, die sich als erstaunlich anschlussfähig erwies – von der k.u.k.-Monarchie bis zur amerikanischen Prohibition.
Doch die Bedingungen, unter denen dieses Modell entstand und prosperierte, existieren nicht mehr. Was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts funktionierte – die Verbindung von regionaler Verankerung, Familienbesitz und nationaler Expansion –, gerät heute unter systematischen Druck. Die aktuellen Herausforderungen machen deutlich, dass es nicht mehr nur um Marktanteile und Marketingstrategien geht, sondern um die Überlebensfähigkeit einer gesamten Unternehmensform.
Die gestiegenen Energiepreise seit 2021 treffen inhabergeführte Brauereien mit besonderer Härte. Brauen ist ein energieintensiver Prozess: Maischen, Kochen, Kühlen, Abfüllen – jeder Schritt verbraucht erhebliche Mengen an Strom und Gas. Was für die Großen eine kalkulierbare Kostenposition ist, wird für kleine und mittlere Betriebe zur existenziellen Bedrohung. Große Konzerne können Energiepreise langfristig hedgen, verfügen über Verhandlungsmacht gegenüber Versorgern und können Preissteigerungen durch Skaleneffekte teilweise kompensieren. Familienbrauereien fehlt diese Kapitalisierungstiefe. Sie müssen Preissteigerungen entweder an ihre Kunden weitergeben – und riskieren damit Marktanteile – oder ihre Margen opfern. Beides gefährdet langfristig die Substanz.
Gerade für Brauereien wie Potts, Strate, Barre Bräu, Hohenfelder, Moritz Fiege oder Warburger wird diese Kostenexplosion zum strukturellen Problem. Sie sind zu groß, um als Nischenanbieter mit Premiumpreisen zu operieren, aber zu klein, um die Kostenstrukturen der Großen zu erreichen. Sie befinden sich in einer wirtschaftlichen Zwischenzone, in der die traditionellen Vorteile mittelständischer Strukturen – Flexibilität, Kundennähe, Qualitätsorientierung – nicht mehr ausreichen, um die strukturellen Nachteile bei Energie-, Personal- und Kapitalkosten zu kompensieren.
Hinzu kommt der strukturelle Wandel im Konsumverhalten. Der Bierkonsum in Deutschland ist seit Jahrzehnten rückläufig, die Zahl der Brauereien sinkt kontinuierlich. Was bleibt, ist ein Verdrängungswettbewerb, in dem nicht Qualität oder Tradition entscheiden, sondern Listungspreise im Lebensmitteleinzelhandel und Marketingbudgets. Hier haben Konzernstrukturen systematische Vorteile: Sie können Verluste einzelner Marken quersubventionieren, verfügen über professionelle Vertriebsstrukturen und können Skaleneffekte in Produktion und Logistik realisieren.
Die westfälischen Großbrauereien – Krombacher, Veltins, Warsteiner – haben diese Schwelle längst überschritten. Sie sind groß genug, um im Konzentrationsprozess zu bestehen, professionell genug, um mit Konzernen zu konkurrieren, und haben gleichzeitig ihre Familienstrukturen bewahrt. Aber sie sind die Ausnahme, nicht die Regel. Die Mehrzahl der regionalen Brauereien steht vor der Frage, ob das Modell der inhabergeführten Brauerei überhaupt noch zukunftsfähig ist – oder ob es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie von größeren Playern übernommen oder vom Markt verschwinden.
Was dabei verloren geht, ist mehr als nur eine Unternehmensform. Mit den regionalen Brauereien verschwindet ein Stück wirtschaftlicher Dezentralität, regionaler Identität und unternehmerischer Autonomie. An ihre Stelle treten Marken ohne Orte, Produkte ohne Geschichte, Marketing ohne Substanz.
Die westfälische Braugeschichte zeigt, dass es auch anders geht – sie zeigt aber auch, dass die Bedingungen dafür historisch spezifisch waren und sich nicht beliebig reproduzieren lassen.
Die Frage ist nicht, ob inhabergeführte Brauereien überleben können. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen sie überleben können – und ob eine Wirtschaftspolitik, die auf Marktkonzentration, Skaleneffekte und globalen Wettbewerb setzt, überhaupt noch Raum für mittelständische Strukturen lässt. Die westfälische Brautradition ist ein Lehrstück darüber, was möglich war. Sie ist zunehmend auch ein Lehrstück darüber, was verloren geht.