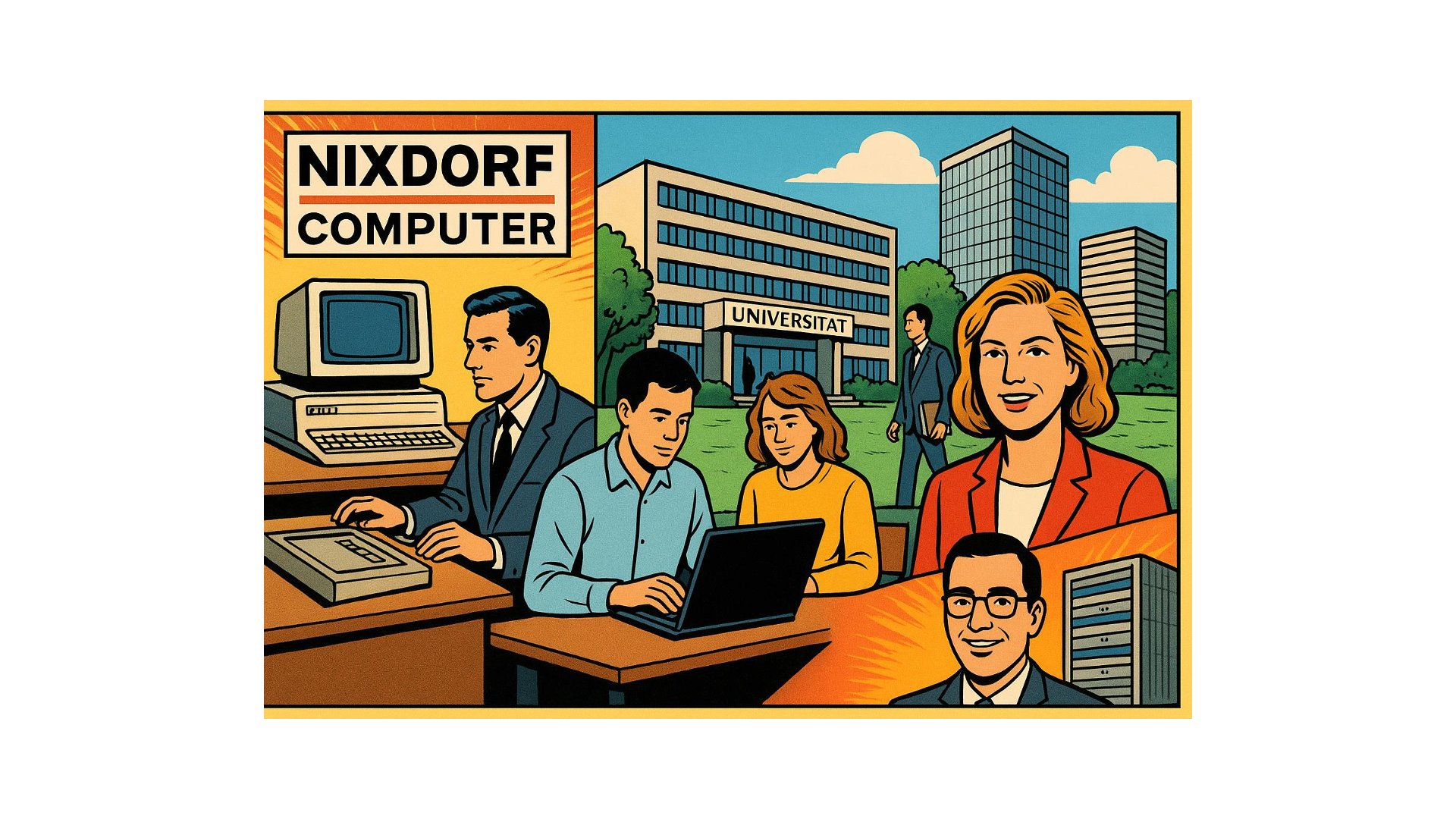Von den ersten Digitalrechnern bei Siemens bis zu milliardenschweren IT-Konzernen: Westfalen hat die deutsche Informatiklandschaft maßgeblich geprägt. Während in den Nachkriegsjahren an den Universitäten Dortmund und Paderborn die Grundlagen für eine neue Wissenschaftsdisziplin gelegt wurden, schrieben westfälische Pioniere wie August-Wilhelm Scheer und Stephanie Shirley Technologie- und Unternehmensgeschichte. Ein Blick auf eine Region, die aus dem Schatten der Schwerindustrie in die digitale Moderne aufbrach.
Der stille Triumph einer Region
Die Informatik ist längst zum unsichtbaren Rückgrat unserer Wirtschaft geworden. Doch während Silicon Valley als Synonym für Innovation gilt, übersieht man oft, dass auch deutsche Regionen entscheidende Beiträge zur Computerrevolution geleistet haben. Westfalen, traditionell geprägt von Kohle und Stahl, entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der wichtigsten Informatikstandorte Deutschlands – eine Transformation, die so bemerkenswert wie folgenreich war.
Universitäten als Keimzellen der Innovation
Der Grundstein für Westfalens Informatik-Erfolg wurde in den Hörsälen gelegt. An den Universitäten Dortmund und Paderborn entstanden die ersten und bis heute größten Informatik-Fakultäten der Region. Diese akademischen Zentren wirkten wie Magneten für Talente und Unternehmen gleichermaßen. Die außergewöhnlich hohe Dichte an IT-Firmen in beiden Städten ist das direkte Ergebnis dieser weitsichtigen Investition in Bildung und Forschung.
Die Universität Paderborn wurde dabei zu einem Leuchtturm der Theoretischen Informatik. Als Burkhard Monien und Friedhelm Meyer auf der Heide 1992 den prestigeträchtigen Leibniz-Preis erhielten, unterstrich dies die internationale Ausstrahlung westfälischer Forschung. Kollegen wie Gregor Engels und Reinhard Keil setzten diese Tradition fort und formten Generationen von Informatikern.
Besonders faszinierend ist die Behauptung, dass möglicherweise die weltweit erste Informatik-Vorlesung an der Universität Münster gehalten wurde. Heinrich Scholz, der in engem Kontakt zu dem britischen Mathematiker Alan Turing stand, könnte damit Westfalen einen weiteren historischen Superlativ beschert haben.
Ebenfalls an der Universität Münster wirkte Dieter Rödding, ein Visionär, der seiner Zeit weit voraus war. Der 1937 in Hattingen geborene Mathematiker setzte bereits in den 1960er Jahren – lange vor der offiziellen „Geburt“ der Informatik als eigenständige Disziplin – einen maschinenorientierten Komplexitätsbegriff für die Untersuchung rekursiver Funktionen und logischer Entscheidungsprobleme ein. Diese frühen Arbeiten zur Komplexitätstheorie legten theoretische Grundsteine für die spätere Entwicklung der Informatik.
Pioniere zwischen Theorie und Praxis
Westfalen brachte jedoch nicht nur exzellente Forscher hervor, sondern auch Praktiker, die den Sprung von der Theorie in die Anwendung meisterten. August-Wilhelm Scheer verkörpert diesen Typus des Wissenschaftsunternehmers par excellence. Als Gründer der IDS Scheer AG und heutiger Chef der Scheer-Group wurde er zum wohl bekanntesten IT-Unternehmer der Region.
Ein anderes Beispiel für die Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft ist Volker Gruhn. Der Dortmunder gründete 1997 die adesso AG, die heute über 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. Gleichzeitig blieb er der Wissenschaft als Professor an der Universität Duisburg-Essen treu – ein Beweis dafür, dass sich Theorie und Praxis fruchtbar ergänzen können.
Lorenz Hanewinkel verkörpert einen anderen Typus des westfälischen Informatikers: den praktischen Ingenieur mit unternehmerischem Gespür. Der 1931 in Thüringen geborene Physiker kam über die Zuse KG nach Westfalen, wo er ab 1964 entscheidend an der Entwicklung der Nixdorf-Computer mitwirkte. Aus der Wanderer Conti und später dem Magnetkontenrechner Nixdorf 820 formte er den ersten Millionenerfolg der Nixdorf Computer AG. Seine Karriere zeigt exemplarisch, wie sich technische Expertise, Erfindungsreichtum und geschäftlicher Weitblick verbinden lassen – nach seinem Abschied von Nixdorf 1981 startete er erfolgreich eine zweite Laufbahn als Patentanwalt.
Heinz Gumin aus Dortmund schrieb bereits in den Anfängen der Computerära Geschichte, als er die Softwareentwicklung für den ersten serienmäßig gefertigten Digitalrechner von Siemens leitete. Seine spätere Rolle als Vorstand für den Unternehmensbereich Datentechnik zeigt, wie westfälische Experten auch in Großkonzernen Verantwortung übernahmen.
Kreativität und technische Exzellenz
Westfalen brachte jedoch nicht nur Geschäftsmänner und Forscher hervor, sondern auch kreative Köpfe, die Informatik-Geschichte schrieben. Kai Krause revolutionierte mit seinen Grafikprogrammen die Softwarelandschaft und wurde 2005 von der DEMO-Konferenz als einer der Top-Innovatoren der letzten 15 Jahre ausgezeichnet.
Die Bandbreite der Expertise zeigt sich auch in Spezialgebieten: Erich Hüttenhain als bedeutender Kryptoanalytiker, Hans-Wilhelm Schüßler als Pionier der digitalen Signaltechnik oder Peter Liggesmeyer als führender Experte für Softwaretests und -verifikation. Letzterer leitet nicht nur das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering, sondern steht auch als Präsident der Gesellschaft für Informatik an der Spitze der deutschen Informatiker-Community.
Eine besondere Stellung nimmt Bernhard Korte ein, der 1938 in Bottrop geboren wurde. Als Professor für Diskrete Mathematik an der Universität Bonn gründete er 1988 das Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik und etablierte dieses Fachgebiet in Deutschland. Doch Kortes Vision ging weit über die reine Forschung hinaus: Mit der Gründung des Arithmeums in Bonn schuf er 2008 eine einzigartige Verbindung von Wissenschaft, Technik und Kultur. Seine persönliche Sammlung von über 10.000 Rechenmaschinen – die weltweit umfassendste ihrer Art – schenkte er dem Land Nordrhein-Westfalen. Das mit 5 Millionen DM aus Bonn-Berlin-Ausgleichsmitteln finanzierte Museum verkörpert den westfälischen Geist, der technische Innovation mit kultureller Bildung verbindet und von mechanischen Rechenmaschinen bis zur modernen Informatik reicht.
Noch monumentaler ist das Vermächtnis von Heinz Nixdorf in Paderborn: Das nach ihm benannte Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) ist das weltgrößte Computermuseum und dokumentiert 5.000 Jahre Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnik. Auf 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche spannt es den Bogen von der Keilschrift bis zur künstlichen Intelligenz. Das 1996 eröffnete Museum ist nicht nur eine Hommage an den westfälischen Computerpionier, sondern auch ein lebendiges Zentrum der Technologievermittlung, das jährlich Hunderttausende von Besuchern anzieht und Westfalens Rolle als Wiege der deutschen Informatik eindrucksvoll dokumentiert.
Internationale Verbindungen und tragische Wendungen
Die westfälische Informatik-Geschichte ist auch geprägt von internationalen Verflechtungen und den dunklen Kapiteln deutscher Geschichte. Hugo Wolfram, der Vater des berühmten Computerwissenschaftlers Stephen Wolfram, wurde 1925 in Bochum geboren, musste aber 1933 vor den Nazis nach England fliehen.
Noch bemerkenswerter ist die Geschichte von Stephanie Shirley, geboren als Vera Buchtal 1933 in Dortmund. Nach ihrer Flucht nach England wurde sie zu einer der erfolgreichsten IT-Unternehmerinnen ihrer Zeit. Ihr Unternehmen F International erwirtschaftete bereits 1987 zehn Millionen Pfund Umsatz. Als es 1996 an die Börse ging, wurden rund siebzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Millionären – ein früher Beweis dafür, dass Mitarbeiterbeteiligung zu außergewöhnlichem Erfolg führen kann.
Das Vermächtnis einer transformierten Region
Westfalens Beitrag zur Informatik zeigt exemplarisch, wie sich traditionelle Industrieregionen neu erfinden können. Aus einer Landschaft von Zechen und Hochöfen entstand ein Ökosystem aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und innovativen Unternehmen. Namen wie Balzert, Schumann, Feldmann und Korte stehen für die Kontinuität dieser Entwicklung bis in die Gegenwart.
Die Geschichte der westfälischen Informatik ist mehr als eine regionale Erfolgsgeschichte. Sie zeigt, dass Innovation nicht an bestimmte Orte gebunden ist, sondern dort entsteht, wo Bildung, Forschung und unternehmerischer Mut zusammenkommen. In einer Zeit, in der Deutschland seine digitale Zukunft gestalten muss, können wir von den westfälischen Pionieren lernen: Erfolg entsteht nicht durch Zufall, sondern durch die bewusste Entscheidung, in Wissen und Menschen zu investieren.
Quelle:
Westfälische Informatikerinnen und Informatiker